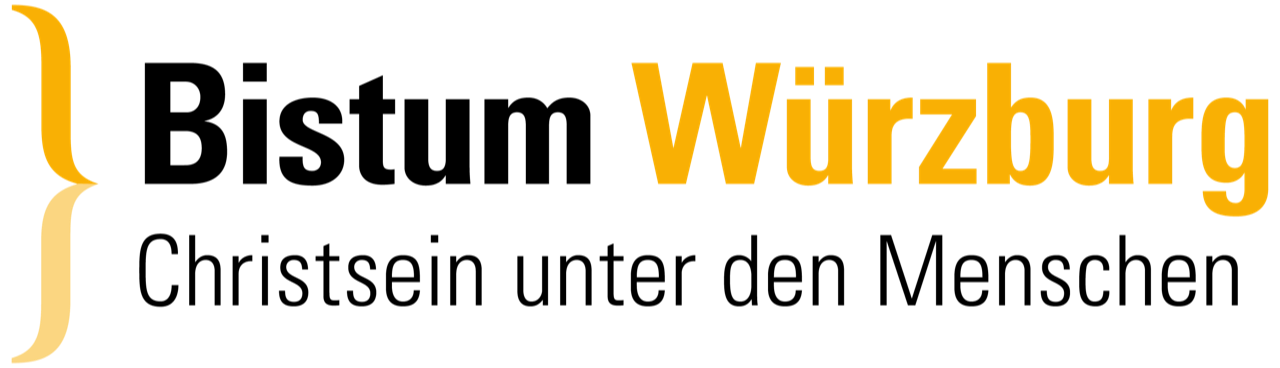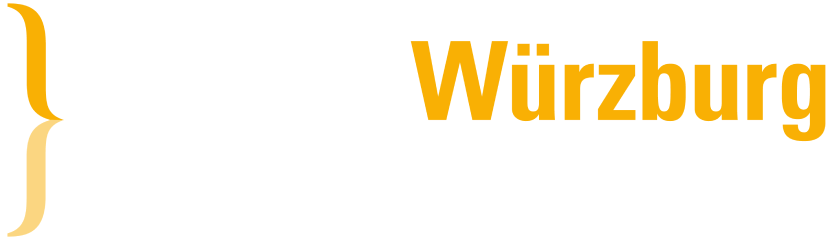ist der Hauptabteilung II "Seelsorge" des Bischöflichen Ordinariates zugeordnet, hier konkret dem Bereich VII: "Diakonische Pastoral".
Die Notfallseelsorge der Diözese Würzburg wird als Fachstelle vom Diözesanbeauftragten verantwortet.
Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ausgebildet und nach Vorschlag des Leiters der Notfallseelsorge vom Generalvikar beauftragt. Sie bilden die Teams der regionalen Systeme, verantwortet jeweils von einem Systemleiter.
Vor Ort wird ein gemeinsamer Dienstplan mit den Teams der evangelischen Notfallseelsorge sowie nichtkirchlicher Anbieter der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV-B) erstellt, der die erforderliche Rufbereitschaft rund um die Uhr abdeckt.
Unsere Fürsorge für die NotfallseelsorgerInnen selbst geschieht u.a. durch ökumenische Teamtreffen, Supervision, regelmäßige Fortbildungen und Ehrenamtstage. Die Einsatzberichte werden auf diözesaner und auf Systemleitungsebene